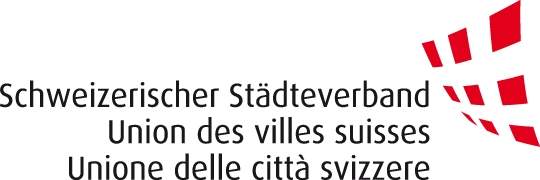Wie reagieren die Schweizer Städte auf den Klimawandel?
Prof. Martine Rebetez, Universität Neuenburg und Eidg. Forschungsanstalt WSL
In den Schweizer Städten gibt es noch viel Potenzial für Emissionsreduktionen. Zwar verfügen sie meist bereits über eine gute ÖV-Infrastruktur; die sanfte Mobilität kann jedoch noch erheblich erleichtert und gefördert werden. Dabei geht es vor allem darum, die Sicherheit und den Komfort für den Fuss- oder Veloverkehr zu verbessern, wobei darauf zu achten ist, dass die Wege bei Hitzeperioden im Schatten und abseits von der Lärm- und Schadstoffbelastung durch den motorisierten Verkehr verlaufen. Die Fortbewegung zu Fuss oder mit dem Velo stärkt die Gesundheit einer allzu bewegungsarmen Bevölkerung und trägt zum Wohlbefinden und zur Geselligkeit bei.
Auch beim Güterverkehr gibt es noch grosses Verbesserungspotenzial, zum Beispiel mit dem Umladen von Gütern auf leichte Fahrzeuge, Velos oder Elektrofahrzeuge an Stadteinfahrten. Für die motorisierte individuelle Mobilität ist die elektrische Lösung nicht das Allheilmittel, aber sie ist in Bezug auf das CO2-Budget und die globale Energiebilanz deutlich besser als Verbrennungsmotoren.
Solarproduktion im Rückstand
Bei Immobilien ist die Verbesserung der Gebäudehülle zwar im Gange, aber der Prozess sollte beschleunigt werden. Fernwärme, die auf dem Wärmeaustausch mit See- und Flusswasser basiert, kann nicht nur Wärme im Winter erzeugen, sondern auch Kälte im Sommer, was zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Die Erzeugung von Solarenergie, ob thermisch oder photovoltaisch, ist in den Städten proportional im Rückstand, teilweise aufgrund des geringen Interesses von Eigentümern oder mangelnder Koordination zwischen den Besitzern von Eigentumswohnungen. Den Gemeinden kommt dabei eine wichtige Rolle zu, indem sie den Übergang erleichtern und fördern können.
Was die Energieversorgung angeht, so kann Kernenergie in der Schweiz keine Lösung mehr sein. Die aussergewöhnliche Nähe der Kraftwerke zu den Städten führte dazu, dass ein Unfall im Gegensatz zu anderen Ländern unverhältnismässige Folgen hätte. Ausserdem wirkt sich der Klimawandel ungünstig aus, da die Kraftwerke auf eine Kühlung durch Gewässer angewiesen sind, die durch Dürreperioden und steigende Temperaturen in Mitleidenschaft gezogen werden. Darüber hinaus handelt es sich um einen nicht erneuerbaren Brennstoff, der häufig gar in russischen Kohlekraftwerken angereichert wird.
Schwachstellen der Städte
Die Stadtbevölkerung ist Hitzewellen, die sich extrem schnell häufen und verstärken, besonders ausgesetzt. Messungen in der Stadt Neuenburg haben beispielsweise gezeigt, dass selbst in einer Kleinstadt bei Hitzespitzen die Temperaturen in städtischen Gebieten um mehrere Grad höher liegen als bei Messungen in Grünzonen. Die Raumplanung kann hierbei einiges bewirken. Zu den Empfehlungen gehören insbesondere begrünte Flächen mit grossen Bäumen sowie der Einsatz von Wasser. Denn die Vegetation kann ihre klimatisierende Funktion nur erfüllen, wenn sie auch in Trockenzeiten über ausreichend Wasser verfügt.
Der Klimawandel verstärkt den Wasserkreislauf und erhöht das Risiko von Dürreperioden, aber auch von Überschwemmungen und Murgängen. In der Schweiz liegen die meisten Städte im Flachland an Seen oder Flüssen. In der jüngsten Vergangenheit gab es zahlreiche Beispiele für Katastrophen, von kurzen, intensiven Gewitterereignissen über sintflutartige Niederschläge, bis hin zum Zusammenwirken von starkem Regen und der Schneeschmelze in Hochlagen.
Der Zusammenhang zwischen starken Niederschlägen und Überschwemmungen hängt zu einem grossen Teil von baulichen Eingriffen, der Vegetation, dem Zustand des Flussbetts und der Hänge ab. Die Ausgestaltung obliegt teilweise direkt der Stadtgemeinde, doch die meisten Verbesserungen müssen im vorgelagerten Bereich und in von den Kantonen abhängigen Gebieten vorgenommen werden. Wenn in Flussbetten stromaufwärts und vor den Ortseingängen der Städte Murbrecher eingebaut werden, d. h. Rechen, die die grössten Trümmerteile herausfiltern, können Katastrophen weitgehend reduziert werden. Weiter gibt es Möglichkeiten, das Management von Staudämmen so zu optimieren, dass diese in Krisensituationen einen Teil des überschüssigen Wassers aufnehmen können.
In Entscheidungsverfahren, die angesichts der raschen Erhöhung der Klimarisiken oft zu schleppend vorankommen und zu langwierig sind, müssen sich die potenziell gefährdeten Städte Gehör verschaffen. Im Hinblick auf den Klimawandel sind die Städte zwar exponiert, aber auch besonders lösungsorientiert.