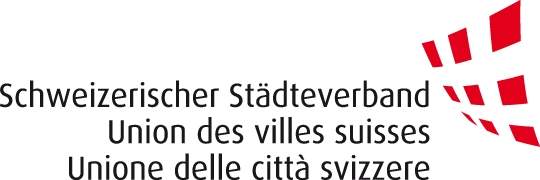«Der Handlungsspielraum der Städte wird kleiner»
1. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die dritte Staatsebene (Städte und Gemeinden)?
Es ist die kommunale Ebene, auf der die Entscheide im Alltag der Einwohnenden konkret Form annehmen. In Nyon wie auch anderswo stehen wir an vorderster Front, wenn es darum geht, die oftmals auf anderen Ebenen in die Wege geleitete Politik der öffentlichen Hand umzusetzen. Die Städte sind ausserdem Orte der Innovation, «Laboratorien», in denen Massnahmen erprobt, angepasst und auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Mit dieser Bürgernähe ist eine enorme Verantwortung gepaart mit einzigartigen Gestaltungsmöglichkeiten verbunden.
2. Inwieweit fühlt sich Nyon auf Kantons- und Bundesebene vertreten?
Wir haben zwar institutionelle Ansprechstellen, aber eine Vertretung ist nur teilweise gegeben. Zu oft werden bei Entscheiden auf Kantons- oder Bundesebene die lokalen Besonderheiten von mittelgrossen Städten wie Nyon nicht berücksichtigt. Dabei sind wir es, die mit den direkten Auswirkungen dieser Entscheide umgehen müssen. Manchmal hat man das Gefühl, dass es eine Diskrepanz zwischen den mitunter dogmatischen politischen Leitlinien und den Realitäten vor Ort gibt. Es wäre wünschenswert, dass die Stimme der Städte besser gehört und in die Gestaltung der sie betreffenden Politik einbezogen wird.
3. Beachtet der Bund die besondere Situation der Städte und Agglomerationen ausreichend, so wie es in Artikel 50 der Bundesverfassung vorgesehen ist?
Nicht genug, nein. In Artikel 50 ist die Gemeindeautonomie verankert, doch in der Realität bleibt diese Anerkennung oftmals reine Theorie. Die realen Gegebenheiten in den Städten sind punkto Bevölkerungsdichte, Mobilität und Siedlungsdruck komplex und hätten eine differenzierte Politik verdient. Allzu oft werden die bundesrechtlichen oder kantonalen Normen einheitlich gestaltet, ohne die Sachzwänge und Erwartungen der jeweiligen städtischen Bevölkerung zu berücksichtigen. Die Rolle der Städte als gleichberechtigte Partner kommt noch nicht voll zum Tragen.
4. Können Sie Beispiele nennen, in denen ein Entscheid auf Kantons- oder Bundesebene den Interessen von Nyon geschadet hat?
Einer der anschaulichsten Fälle ist das Projekt des neuen Genfersee-Museums, das vier Jahre lang vor dem Bundesgericht blockiert war. Inzwischen sind neue ISOS-Regeln in Kraft getreten, und das Projekt wurde anhand von Kriterien beurteilt, die nach seiner Planung aufgestellt wurden. Diese Rechtsunsicherheit ist nachteilig.
Ein weiteres Beispiel: die zukünftige öffentliche Grünanlage mit Tiefgarage an der Place Perdtemps. Hier haben neue Regeln für den Baumbestand die laufenden Verfahren komplizierter gemacht, mit der Folge, dass das Projekt überarbeitet werden musste. Diese Situationen zeigen, wie sehr kommunales Handeln durch Entscheide auf höheren Ebenen behindert werden kann.
5. Welches sind heute die grössten Hindernisse für die Gemeindeautonomie? Was sollte der Bund tun?
Bei jeder neuen Problematik wird ein Gesetz, eine Richtlinie oder eine Norm hinzugefügt. Das Ergebnis: Der Handlungsspielraum der Städte wird kleiner und die Verwaltung immer komplexer. Selbst wenn man innovativ sein möchte, überwiegen die Befürchtungen der höheren Instanzen, und im Zweifel wird blockiert.
Der Bund sollte für ein besseres Gleichgewicht zwischen Regulierung und Autonomie sorgen und einen Rahmen bieten, der die Vielfalt der lokalen Realitäten berücksichtigt.
6. Würden Sie sich eine Stärkung der Gemeindeautonomie in Nyon wünschen?
Ja. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Übertragung von Aufgaben: Autonomie setzt auch Ressourcen, Kompetenzen und eine echte Entscheidungsfähigkeit voraus. Heute haben wir manchmal das Gefühl, mit weniger mehr tun zu müssen, und das in einem immer engeren Rahmen. Die Autonomie zu stärken bedeutet, anzuerkennen, dass die Gemeinden in der Lage sind, komplexe Herausforderungen zu bewältigen, sofern man ihnen vertraut.
7. Sollten Gemeindezusammenschlüsse gefördert werden, um diese Autonomie zu stärken?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Gemeindezusammenschlüsse ein zukunftsweisender Weg sind. Durch die Bündelung der Kräfte können Dienstleistungen professionalisiert, Ressourcen gemeinsam genutzt und die Erwartungen der Bevölkerung besser erfüllt werden. Es geht nicht darum, die lokalen Identitäten zu verwischen, sondern darum, stärkere, effizientere und besser gerüstete Gemeinschaften aufzubauen, die den Herausforderungen von morgen gewachsen sind.