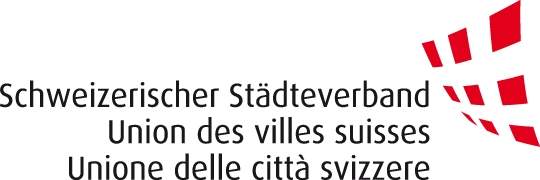«Das Bundesparlament ist ein wichtiger Treiber der Zentralisierung»
Adrian Vatter ist Professor für Schweizer Politik und Direktor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern.
Rahel Freiburghaus ist Assistenzprofessorin für Schweizer und vergleichende Politik an der Universität Lausanne.
Rahel Freiburghaus, Adrian Vatter, Sie haben in Ihrer Politkolumne für die Tamedia-Zeitungen dargelegt, dass sich immer mehr Kompetenzen von den Kantonen zum Bund verschieben. Kann man eine ähnliche Tendenz auch für die Kommunalebene feststellen?
Adrian Vatter: Unser Beitrag basiert auf einer mehrjährigen Studie von Sean Müller und Paolo Dardanelli, welche diese Kompetenzverschiebung wissenschaftlich untersucht haben. Für die Städte und Gemeinden existiert keine solche Studie, wir vermuten aber eine ähnliche Entwicklung.
Wie beurteilen Sie den Grad der Autonomie der Schweizer Städte und Gemeinden?
Adrian Vatter: Im internationalen Vergleich haben die Schweizer Städte und Gemeinden eine grosse Autonomie. Das führt zu einer hohen demokratischen Legitimität, zu mehr Effizienz und Innovation und weniger Korruption. Die Gemeinden sind die Träger der lokalen Demokratie. Gleichzeitig führt die Autonomie auch zu gewissen Ungleichheiten zwischen den Gemeinden. Grundsätzlich würde ich die Autonomie aber positiv bewerten.
Rahel Freiburghaus: Eine neue Studie zeigt sogar, dass die Menschen glücklicher sind, je höher die subnationale Autonomie ist. Korrekterweise müsste man allerdings von Autonomien im Plural sprechen, denn sie ist je nach Kanton sehr unterschiedlich. Tendenziell ist sie in der Ost- und Innerschweiz höher, und in der Romandie tiefer. Zudem haben die Städte und Gemeinden je nach Politikfeld unterschiedlich viel Autonomie. Und nicht zuletzt gilt es nach Art der Autonomie zu unterscheiden: Handelt es sich um Autonomie in Bezug auf die Steuern, die Gesetzgebung oder in Bezug auf die Umsetzung?
Die revidierte Bundesverfassung, die im Jahr 2000 in Kraft trat, enthält den Artikel 50, welcher den Bund verpflichtet, Rücksicht auf die kommunale Ebene zu nehmen. Wie sieht die Bilanz nach 25 Jahren aus?
Adrian Vatter: Der Artikel 50 verstärkt die Akzeptanz und die Legitimation der kommunalen Ebene, und er verpflichtet den Bund, Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse von Städten, Agglomerationsgemeinden und Berggemeinden zu nehmen. Es entstand ein institutionalisierter Dialog durch die Tripartite Konferenz, in der auch der Gemeindeverband und der Städteverband vertreten sind, und die Städte und Gemeinden werden in den Vernehmlassungen besser wahrgenommen. Dadurch, dass es in der Schweiz keine Verfassungsgerichtsbarkeit gibt, können Städte und Gemeinden den Artikel 50 aber nicht einklagen.
Rahel Freiburghaus: Der Artikel 50 kann auch ein Anreiz für die kommunale Ebene sein, ihre Expertise auf Bundesebene aktiv einzubringen. Sie verfügt über gute Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort: Im Bereich der Klimaanpassung zum Beispiel haben sich viele Städte mit dem Konzept der Schwammstadt viel Fachwissen aufgebaut, von dem auch Bund und Kantone profitieren können. Wenn die Gemeinden und Städte dem Bund Sachverstand bieten können, werden sie auch angehört.
Viele Gemeinden und Städte fühlen sich dennoch übergangen und haben den Eindruck, lediglich Vollzugsorgane zu sein.
Rahel Freiburghaus: Die Bundesverwaltung nimmt ihre Pflicht wahr, indem sie die Auswirkungen auf Städte und Gemeinden konsequent mitdenkt. Wir beobachten, dass Zentralisierungsschritte hauptsächlich vom Bundesparlament verursacht werden. Diese entstehen aus einer parteipolitischen Optik heraus. Grund dafür ist unter anderem ein sich veränderndes Karrieremuster bei den Mitgliedern des Bundesparlaments: Die «Ochsentour» wird nicht mehr von allen absolviert, wodurch Erfahrungen aus der Kommunalebene und dadurch auch eine Sensibilität für deren Anliegen fehlen.
Was könnten Lösungsansätze sein?
Adrian Vatter: Einerseits gilt es, die bestehenden Gefässe besser zu nutzen, aber auch an neue zu denken. Die Interessen der Gemeinden und Städte sind heterogen, wodurch der Auftritt gegenüber dem Bund an Bedeutung einbüsst. Die Kantone haben in der Konferenz der Kantonsregierungen ihre Kräfte gebündelt und treten sehr stark auf. Davon könnte die Kommunalebene lernen – vielleicht würde eine «Konferenz der Gemeinde- und Stadtpräsidien» ihr mehr Gewicht verleihen.
Rahel Freiburghaus: Gelegentlich wird ein Städtesitz im Ständerat diskutiert. Das halten wir aber für wenig zielführend, da der Zeitpunkt der Einflussnahme dann zu spät ist. Die Forschung zeigt, dass Lobbyarbeit wirkungsvoller ist, wenn die Mitwirkung so früh wie möglich im Prozess erfolgt.
Interview durchgeführt von Nadja Sutter, Schweizerischer Gemeindeverband, Erstpublikation in «Schweizer Gemeinde».