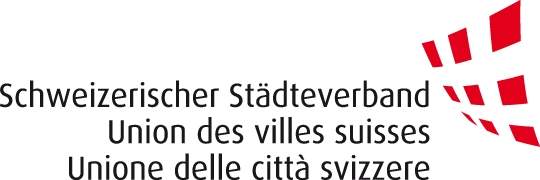25 Jahre Städte in der Bundesverfassung: Ein Meilenstein auf Bewährungsprobe
Vor 25 Jahren wurde der Städte- und Gemeinde-Artikel (Artikel 50) in die Bundesverfassung aufgenommen. Er verankert die Gewährleistung der Gemeindeautonomie im Rahmen des kantonalen Rechtes, verpflichtet den Bund bei seinem Handeln zur Rücksicht auf die kommunale Ebene und betont die besondere Rolle der Städte und Agglomerationen und der Berggebiete. Mit diesem Schritt wurde ein demokratisches Zeichen gesetzt: Städte und Gemeinden sind nicht länger als Vollzugseinheiten oder Bittstellerinnen zu behandeln, sondern als eigenständige Partnerinnen im föderalen Gefüge anzuerkennen.
Dieses Jubiläum ist nun aber nicht ein Anlass für Nostalgie, sondern für eine Erklärung, und ein Plädoyer zum Umsetzen. Denn Artikel 50 ist mehr als eine recht schwammige Rechtsgrundlage oder eine Pflicht. Er ist vielmehr auch ein Versprechen, das eingelöst werden soll.
Errungenschaften – und die Pflicht zur gemeinsamen partnerschaftlichen Gestaltung
Die Aufnahme des Städteartikels war das Ergebnis zäher Auseinandersetzungen. Sie führten zwar zu einem systematischeren Einbezug der Städte und Gemeinden und in gewissen Belangen zu einer strukturierteren Zusammenarbeit, allem voran im Rahmen von Vernehmlassungen und in tripartiten Konferenzen. Diese Mechanismen wirken heute selbstverständlich, doch sie waren Errungenschaften. Wir schätzen vieles daran. Wie es genau um die Berücksichtigung der Stimme der urbanen Schweiz steht, der Wirksamkeit und die Gestaltungsmöglichkeit der Städte, Gemeinden und Agglomerationen, sieht im Einzelfall sehr unterschiedlich aus. – Dabei sprechen wir von besonderer Berücksichtigung der räumlichen Gebiete, die Dreiviertel der Bevölkerung Lebensraum bieten und wo gut 80% der Wirtschaftsleistung des Landes erbracht wird. Entsprechend hoch sind die Steuererträge aus den Schweizer Städten. Wer Politik ohne Städte macht, macht somit Politik ohne die Mehrheit. – Konkret gefragt heisst dies etwa, wie wird eine Vernehmlassungsantwort des Städteverbands gewichtet? Wie gehen die Mitglieder des Bundesparlaments mit Positionen der Städte und Gemeinden um? Und wie soll die besondere Berücksichtigung je nach Situation ausgestalten werden? Tripartite Zusammenarbeiten sind für die Städte wichtig und bieten (respektive bisweilen böten) die Möglichkeit, direkt gemeinsam zu verhandeln und auch neben den offiziellen Traktanden systematisch im Gespräch zu bleiben. Gerade hier stossen wir vor allem dann an unsere Grenzen, wenn statt partnerschaftlicher Zusammenarbeit mittels konkreter Projekte und Herausforderungen lediglich Verwalten gelebt wird. Herausfordernd ist es auch, wenn aus der Partnerschaft eine Zahlungsbereitschaft werden soll, etwa ohne dass die Grundsätze und Aufgaben des Finanz- und Lastenausgleichs respektive des interkantonalen Lasten- respektive Leistungsausgleichs mitdiskutiert würden.
Somit ist eines klar: Ein Verfassungsartikel allein schafft noch keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die Instrumente, die aus ihm entstanden sind, müssen laufend gepflegt, genutzt und weiterentwickelt werden und dürfen nicht auf eine reine formalistische Verwaltung und Alibiübung hinauslaufen. Denn die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Städten ist kein einmaliger Akt, sondern ein dauernder Prozess. Nur so bleibt Artikel 50 lebendig.
Gerade in Krisen zeigt sich, wie fragil diese Zusammenarbeit sein kann. Die Covid-19-Pandemie verdeutlichte, wie unverzichtbar Städte sind und zugleich, wie schnell sie übergangen werden. Sie trugen Verantwortung, mobilisierten Ressourcen, setzten Massnahmen um und wurden dennoch kaum einbezogen. Auch das aktuelle Entlastungspaket 2027 offenbart Brüche: Von 59 Massnahmen wurden nur 36 zur Vernehmlassung gestellt. 1,5 Milliarden Franken Sparvolumen beschlossen Bund und Kantone ohne kommunale Mitsprache, obwohl die Folgen direkt in Schulen, Integrationsarbeit, im Stadtraum und im Alltag der Bevölkerung spürbar sein werden. Das widerspricht klar dem Geist von Artikel 50.
Auftrag und demokratisches Versprechen
Wenn wir den Artikel 50 als einen Auftrag sehen, dass wir die Verantwortung gemeinsam tragen, gilt es die Städte und Gemeinden als Mitgestalterinnen, nicht nur Adressatinnen oder eben unterste Vollzugsbehörden anzuerkennen. Partnerschaft bedeutet Zusammenarbeit auf Augenhöhe, damit verbunden ist die Gestaltungsmacht gerade der Städte anzuerkennen. Doch ein solches Versprechen erfüllt sich nicht von selbst. Es braucht das fortwährende Bemühen und die Bereitschaft aller staatlichen Ebenen, den Dialog ernst zu nehmen, neue Formen der Kooperation auszuprobieren und den föderalen Zusammenhalt aktiv zu pflegen. Dabei sind die Städte als Orte der Innovation zentral, sie wollen ihre Rolle als Labore für Lösungen spielen. Sei es mit einer partizipativen Stadtentwicklung, im Umgang mit Genossenschaften und Wirtschaftsakteurinnen, beim Erreichen ehrgeiziger Klimaziele oder beim sozialen Ausgleich. Ebenfalls sind Städte die Orte, wo Investitionen in öffentliche Infrastrukturen und Innovation für langfristige Lebens- und Standortqualität getätigt werden. Hier entstehen neue Kooperationsformen zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Denn gerade aufgrund der urbanen Vielfalt und Reibung werden tragfähige Ideen hervorgebracht. So waren Städte immer schon Treiberinnen des Fortschritts – auch wenn auf nationaler Ebene Stillstand herrschte. Anne Hidalgo, Stadtpräsidentin von Paris, brachte es auf den Punkt: Städte mögen keine Armeen und Botschaften haben – aber es sind Stadtpräsidentinnen und Stadtpräsidenten, die täglich Veränderungen herbeiführen.
Perspektive und Deklaration
So wird das heurige Jubiläum zu einem Prüfstein. Wir fordern keinen Sonderstatus, sondern die Behandlung als staatliche Partnerinnen: Die Mitgestaltung als Regel, nicht als Ausnahme. Ein Föderalismus kann nämlich nur tragen, wenn Städte ihn mittragen können – und dafür ist der Artikel 50 konsequent weiterzuentwickeln und anzuwenden.
Darum haben der Schweizerische Städteverband und Gemeindeverband eine gemeinsame Deklaration erarbeitet, die am 24. September im Bundeshaus überreicht wird. Sie ist Ausdruck von Kooperation mit Bund und Kantonen, auch von Dank und Respekt, aber auch verbunden mit einer klaren Botschaft: Die kommunale Stimme gehört gehört. Artikel 50 muss ernst genommen – und weitergelebt – werden. Erst dann schafft der einstige Meilenstein die Bewährungsprobe in unserem föderalistischen System.