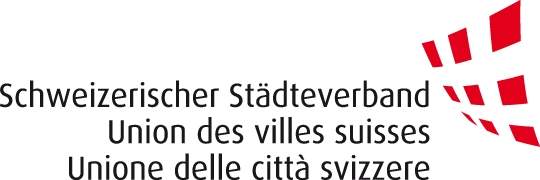Wohnen darf kein Luxus sein
Aline Masé, Leiterin Fachstelle Sozialpolitik bei Caritas Schweiz, Mitautorin Caritas-Positionspapier zu Wohnen und Armut
In der Schweiz gibt es viel zu wenige freie Wohnungen. Die landesweite Leerwohnungsziffer liegt bei einem Prozent, wie das Bundesamt für Statistik Anfang September bekanntgab. Während in vielen Städten längst Wohnungsnot herrscht, erreicht diese immer mehr auch ländliche Regionen. Die Mietpreise sind in den letzten Jahren deutlich stärker gestiegen als die Löhne. Für Personen und Familien mit kleinem Budget macht dies die Wohnungssuche zunehmend zu einer unlösbaren Aufgabe.
Wohnen ist der grösste Budgetposten für Menschen mit tiefen Einkommen. Die ärmsten 20 Prozent der Haushalte geben laut Bundesamt für Statistik im Durchschnitt rund ein Drittel ihres Bruttoeinkommens für Mieten und Energie aus. Dieser Durchschnittswert verschleiert nicht nur die Unterschiede zwischen Regionen und Gemeinden, sondern auch zwischen verschiedenen Haushaltsformen.
Besonders Alleinerziehende und Familien mit tiefen Einkommen wenden häufig deutlich mehr als ein Drittel ihres Einkommens fürs Wohnen auf. Dies zeigen aktuelle Daten aus dem Nachfragemonitor, der Wohnungsinserate und Bewerbungsdossiers auswertet. Die Erfahrungen aus den Caritas-Sozialberatungen bestätigen dies. Wir stellen fest, dass manche Familien nach einem Wohnungswechsel gar mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete einsetzen müssen. Gleichzeitig belastet sie der ungebrochene Anstieg der Krankenkassenprämien. Sie verschulden sich und beginnen bei der Ernährung oder der Gesundheit zu sparen – auf Kosten ihres persönlichen Wohlergehens.
Studien weisen auf eine zunehmende Segregation hin: Finanziell besser gestellte Haushalte können sich die Kosten in bevorzugten städtischen Quartieren leisten und bleiben dort zunehmend unter sich. Ärmere Haushalte werden verdrängt. Sie müssen in periphere oder lärmgeplagte Gegenden ausweichen, auf Wohnungen, die oft zu klein oder in schlechtem Zustand sind. Dabei werden sie aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen. Dieses ist für Kinder sehr wichtig – und für Eltern, die auf Unterstützung aus der Nachbarschaft angewiesen sind, ebenso.
Wohnen darf nicht zum Luxus werden. Es braucht mehr Wohnraum, der auch für ärmere Haushalte tragbar ist. Eine aktive Wohnbaupolitik von Städten ist zentral, um dieses Ziel zu erreichen. Sie sollten auch gemeinnützige Wohnbauträger gezielt fördern. Kurzfristig braucht es direkte Hilfe für gefährdete Gruppen: Mietzinsbeiträge, Energiekostenzulagen, Bürgschaften für Mietzinskautionen sowie niederschwellige Beratungsangebote sind gezielte Instrumente. Diese kommen an manchen Orten bereits zum Einsatz, aber leider längst nicht überall.