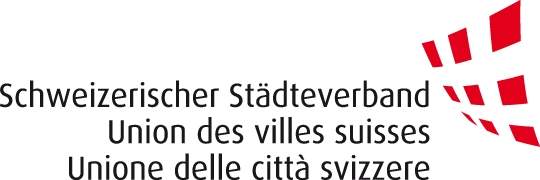Massnahmen der Städte zur Sicherung von Wohnraum für armutsbetroffene Menschen
Flora Senften, Leiterin Stadtplanung, Wohnen und Quartiere
Wohnraum wird für die Bevölkerung der Schweiz zunehmend teurer. Die Miete ist für viele Haushalte einer der grössten Ausgabenposten. Entsprechend gross ist die Herausforderung für armutsbetroffene und armutsgefährdete Menschen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In der Schweiz sind 8,1% (708 000 Menschen) der ständigen Wohnbevölkerung von Armut betroffen, was bedeutet, dass ihr Einkommen nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu decken. Für eine Einzelperson liegt die Armutsgrenze bei 2315 CHF pro Monat, für eine Zweielternfamilie mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 4051 CHF pro Monat (BfS, 2023). Es sind beinahe doppelt so viele Betroffene – 1,4 Millionen – wenn man armutsgefährdete Menschen hinzurechnet. Also jene, deren Einkommen nur knapp über der Armutsgrenze und deutlich unter dem Medianlohn (60% des verfügbaren Medianlohns) liegt.
Die Städte setzen sich für den Erhalt und die Schaffung von Wohnraum für armutsbetroffene und armutsgefährdete Haushalte im Sinne ihres Engagements gegen strukturelle Ungleichheiten ein. Dazu haben sie verschiedene Massnahmen entwickelt:
Objekt- und Subjekthilfe
Grundsätzlich lassen sich Subjekt- und Objekthilfe unterscheiden. Objekthilfe ist die indirekte oder direkte Schaffung von preisgünstigem und gemeinnützigem Wohnraum. Städte schaffen direkt Wohnraum, indem sie für armutsbetroffene und armutsgefährdete Personen Sozialwohnungen, respektive subventionierte Wohnungen bauen. Indirekt können sie das Wohnangebot über Wohnraumförderungen gemeinnütziger Bauträger, durch Anteilsscheine, Bedingungen in Baurechtsverträgen oder Subventionierung fördern.
Subjekthilfe wiederum sind Direktbeiträge, die Haushalte von Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungsbeziehenden bei der Mietzahlung unterstützen. Wichtig ist, dass Mietzinsrichtlinien des jeweiligen Leistungssystems realistisch gestaltet sind, damit Wohnraum tatsächlich bezahlbar bleibt. Bei Ergänzungsleistungen ist der maximal anrechenbare Mietzins national geregelt, bei der Sozialhilfe bestimmen die Gemeinden die Mietzinsrichtlinien. Liegen die Beiträge zu tief, müssen Betroffene einen Teil der Miete aus der ohnehin schon knappen Sozialhilfe bezahlen und leben noch prekärer. Sozialdienste brauchen daher ausreichend Handlungsspielraum, um die Übernahme sicherzustellen.
Je nach kantonalen Gesetzen werden Mietzinszuschüsse für weitere Haushalte, insbesondere für Familien, ausgezahlt, so in den Kantonen Genf, Basel-Stadt und Baselland. Basel-Stadt weitete die Mietzinszuschüsse kürzlich auf Einzelpersonen aus. Zusätzlich können Städte die Wohnungssuche mit Mietkautionsgarantien unterstützen.
Beratung und Unterstützung bei Wohnungssuche und in Notsituationen
Bei der Wohnungssuche unterstützen die Städte die Mietenden mit Wohnberatungen, so etwa in Bern, Zürich und Baden. Diese Wohnberatungen und -begleitungen tragen dazu bei, dass sich die Wohnsituation der Mietenden langfristig stabilisiert.
In Notsituationen ist es wichtig, dass die betroffenen Menschen schnell und niederschwellig beraten und unterstützt werden. Die Schulung von Personal in Bevölkerungsdiensten, Sozialdiensten, Quartierarbeit und aufsuchender Sozialarbeit sorgt dafür, dass Betroffenen zielgerichtet weiterverwiesen werden. Gewisse Städte bieten finanzielle Unterstützung, um Mietausfälle zu vermeiden, Kündigungen zu verhindern oder Notwohnungen bereitzustellen, um Menschen vor Obdachlosigkeit zu bewahren. In Lausanne unterstützt das Dispositif aide sociale au logement (DASL) Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, bis eine neue Wohnung gefunden ist und sich die Wohnsituation somit stabilisiert hat.
Preisgünstiger Wohnraum in den Städten als Garant für eine durchmischte Stadtbevölkerung
In vielen Städten haben längst nicht nur armutsbetroffene und -gefährdete Menschen Schwierigkeiten, eine für ihr Budget passende Wohnung zu finden. Es betrifft insbesondere auch Familien und Einpersonenhaushalte. Preisgünstiger Wohnraum ist daher nicht nur für Armutsbetroffene und armutsgefährdete Haushalte wichtig, sondern auch für die Mittelschicht. Wohnraum ist ein Grundbedürfnis. Weniger Mietbelastung ermöglicht den Haushalten, Einkommen für andere (Konsum-)ausgaben und für die Altersvorsorge zu verwenden oder für Wohneigentum anzusparen.
Zudem ist ein ausgeglichenes Wohnraumangebot eine wesentliche Voraussetzung für eine diverse, attraktive und ökonomisch stabile Stadtgesellschaft. Die Dringlichkeit ist heute gross, Wohnraum für armutsbetroffene und armutsgefährdete Menschen zu sichern. Gleichzeitig braucht es mehr preisgünstigen Wohnraum, damit Städte weiterhin für alle attraktiv bleiben.